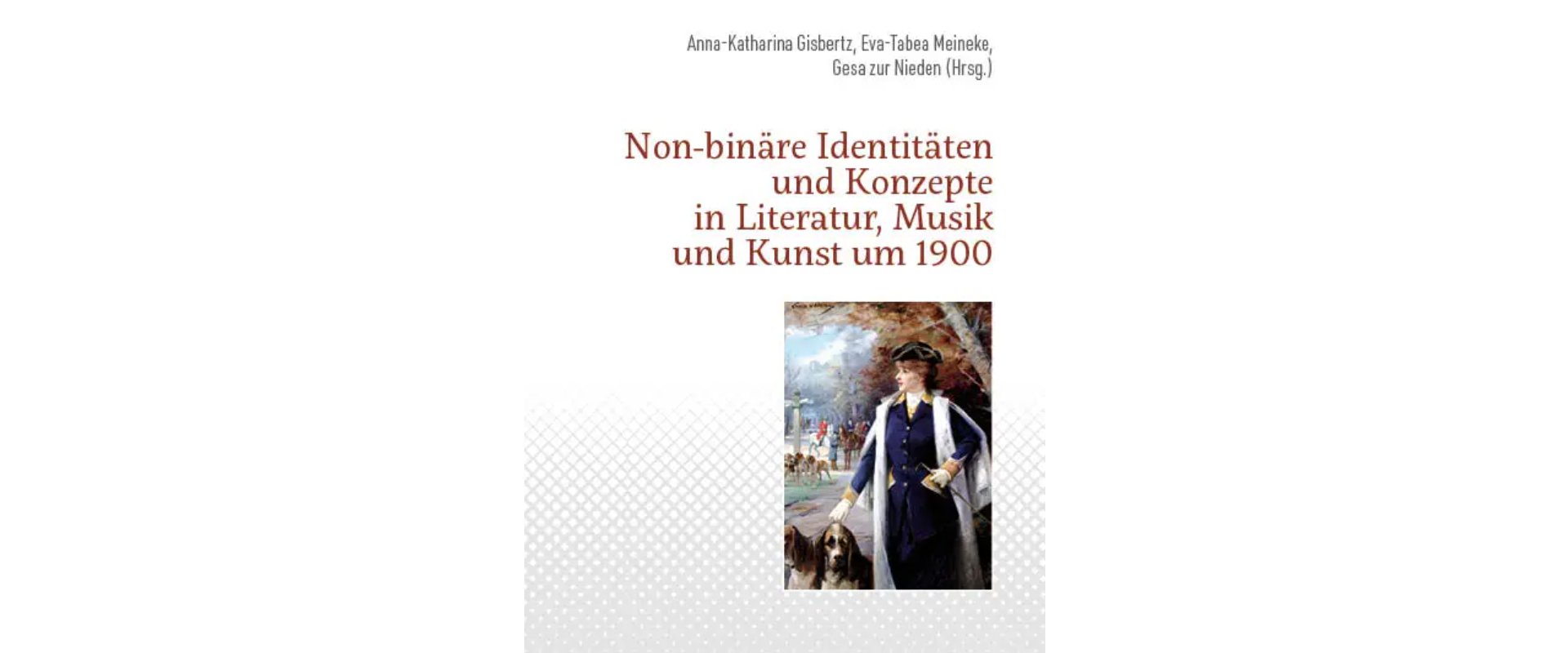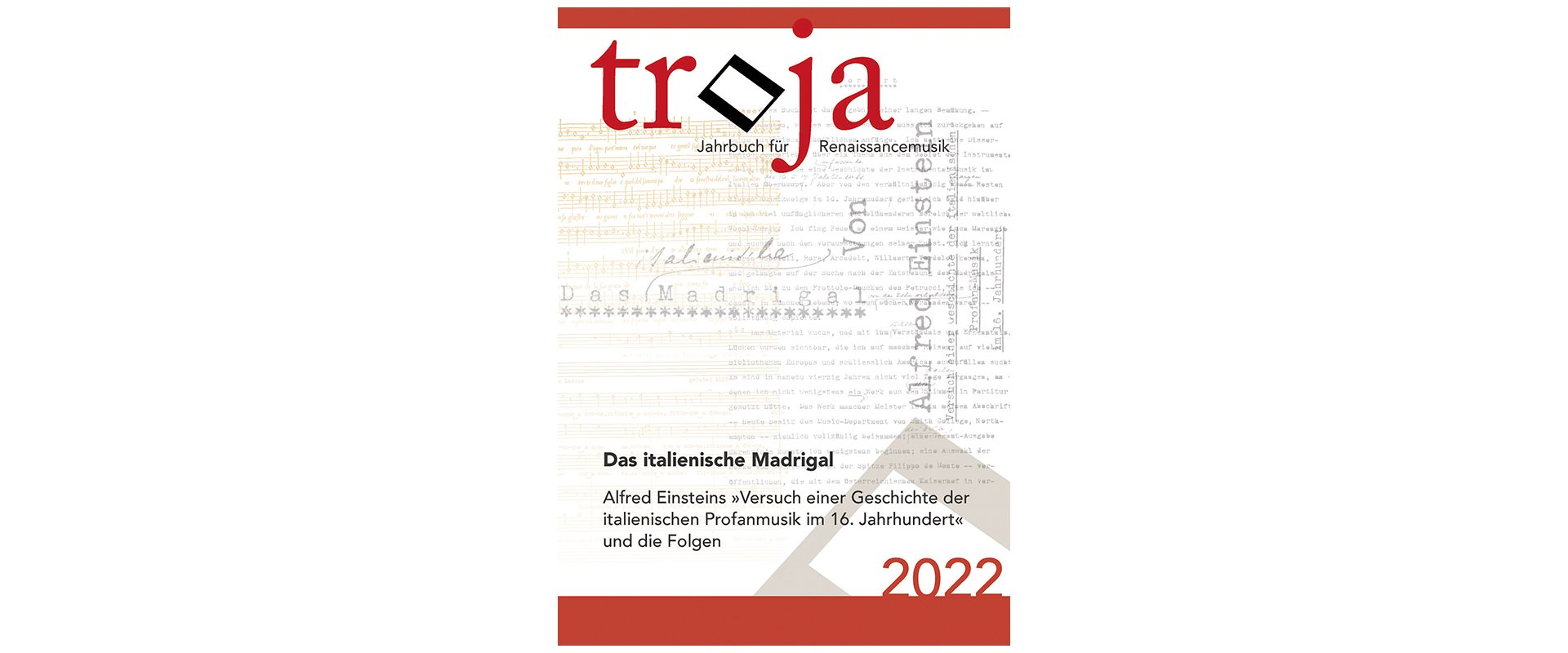Forschung
Musikwissenschaftliche Forschung in Augsburg baut auf den traditionellen musikologischen Forschungsrichtungen der Philologie als Rekonstruktion und Edition musikalischer Texte sowie der Kulturgeschichte der Musik in ihren inter- und transdisziplinären Vernetzungen mit den Geschichts-, Kunst- und Literaturwissenschaften, der Ethnologie und Anthropologie sowie der Soziologie und Philosophie auf. Im Zentrum steht die Frage, auf welche Weise musikalische Praktiken und Erscheinungsformen mit historischen und aktuellen soziokulturellen Prozessen zusammenhängen. Dazu gehören sowohl globale Vernetzungen und ihre Auswirkungen auf den Musikbegriff als auch der mediale Wandel, der sich auf die Produktions- und Rezeptionsformen von Musik niederschlägt. Durch eine multiperspektivische, transferorientierte und begriffskritische Untersuchung musikalischer Artefakte und der damit einhergehenden Praktiken wird es möglich, die Rolle von Musik etwa für das Klimabewusstsein, für das Zusammenleben in pluralen oder ländlichen Gesellschaften sowie für verschiedene politische Entwicklungen näher zu beleuchten. Gleichzeitig ist der Arbeitsbereich an der Weiterentwicklung von Forschungsmethoden der Digital Musicology beteiligt.
Ganz konkret widmet sich die Augsburger Musikforschung den überregionalen und europäischen Vernetzungen des lokalen Musiklebens in seiner Geschichte vom Mittelalter bis heute. In weiteren Forschungsprojekten geht es um die Produktion populärer Musik zur Zeit des Nationalsozialismus und dabei auch um die Frage, ob und inwiefern alte Repertoires heute kritisch wieder aufgeführt werden können. Zudem wird der gesellschaftliche Status der Oper als hochsubventionierte Kunstform und die politische Auseinandersetzung mit Musik in der Nachkriegszeit erforscht. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der frühneuzeitlichen Mobilitäts- und Transfergeschichte von Musik, hier unter anderem in Bezug auf Leopold Mozarts Violinschule.
In den Projektförderungen ist der Augsburger Arbeitsbereich sowohl regional als auch international aufgestellt und kooperiert eng mit der Gesellschaft für Bayerische Musikgeschichte sowie mit den Universitäten oder Musikhochschulen in Linz, Salzburg, Basel, Graz und Warschau.Neue Publikationen aus dem Arbeitsbereich